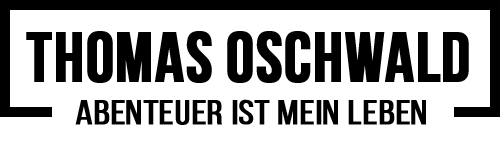Ein wenig mehr als ein Jahr, seitdem ich mich in den verschneiten Bergen der Stubaier Alpen (Österreich) austobte, stand ich unmittelbar vor meiner nächsten Reise. Es war der Tag, an dem sich meine Route entlang der Rhône, gefolgt von Saône, Azergues, Botoret, Sornin, und schlussendlich Frankreichs längstem Fluss der Loire auf schätzungsweise 1500 Kilometern in der Ferne zu verlieren schien. Es war der Tag des Aufbruchs. Der Tag, an dem ich meinen ersten Schritt Richtung Horizont wagte. Der Tag, an dem ich begann, einen weiteren Traum in der Wirklichkeit auszuleben.
Der Weg war nicht immer einfach, schon nach drei Tagen musste ich feststellen, dass ich eine Grenze überschritten hatte und in ein abgrundtiefes Loch fiel. Mein Knie hatte sich von der Last des Rucksackes entzündet, mein Rücken schmerzte mir und mein Fuss schien ausseinander zu brechen. Ich war am Ende meiner Kräfte. Keine 200 Kilometer und schon aus der Traum?
«Warum bin ich vorher nicht einmal trainingshalber von Zürich ins Tessin marschiert», schoss es mir durch den Kopf. Noch über tausend Kilometer Fussmarsch lagen vor mir. Ich hätte mich ein wenig ausspannen können, doch einen Ruhetag bereits nach drei Tagen einzulegen stand genauso wenig zur Diskussion, wie die tägliche Distanz auf wenige Kilometer zu reduzieren. Meine gesamte Motivation beruhte auf dem Faktor Zeit. Ich wollte herausfinden, wozu ich fähig bin, ich wollte danach streben, das Unmögliche möglich zu machen. Es musste also „jetzt“ weitergehen!
Eine unruhige Nacht stand mir bevor und nur langsam, Stück für Stück, stieg ich aus diesem abgrundtiefen Loch empor. Doch dann war plötzlich nichts mehr da von dieser beängstigenden Schwärze, die Sonne schien wieder, und ich wusste plötzlich, dass ich es schaffen konnte. Die Lösung meines Problems war dann auch denkbar einfach. Anstelle meinen Körper weiterhin mit einem Zusatzgewicht von über 20 Kilo zu belasten, schnürte ich kurzerhand
meinen Rucksack auf ein Longboard und zog es, wie ein Schlitten auf Räder, hinter mir her. Da ging ich also mit meinem Rucksack spazieren, meinem „petit chien“, wie ihn die Franzosen liebevoll nannten. Es dauerte auch nicht lange bis ich wieder mein Tagesmittel von 75 Kilometer erreicht. Zwar liessen die Schmerzen im Knie nur zögerlich nach, Erinnerungen daran, dass ich eine Grenze missachtet habe, doch es ging wieder vorwärts. Das war mit damals das Wichtigste. Ich erreichte Lyon, verliess den Lauf der Rhône und querte zu Frankreichs längstem Fluss der Loire hinüber.
Es war von Vorteil, den Flüssen zu folgen. Auch wenn ich dadurch gewisse Umwege in Kauf nehmen musste, hatte ich mit nur wenigen Steigungen zu kämpfen. Meine Nächte verbrachte ich in einem kleinen Einerzelt, an den Ufern der Flüsse, die mich auf meiner Reise begleiteten. Ich legte mich zur Ruhe, als es dunkel wurde und setzte meine Reise in den ersten Sonnenstrahlen fort. Ich ass, wenn ich Hunger
hatte, trank, wenn ich durstig war und rastete, wenn ich mich müde fühlte. Marschieren wurde zu meinem Beruf, zu meinem Alltag, zu meiner Erfüllung, die Schritte mein Werkzeug, um mich und meine Grenzen besser kennen zu lernen. Ich schritt meinem fernen Ziel entgegen und zugleich tief in meine eigene Person hinein. Ich entzündete neue Sterne in meinem inneren Universum. Lichtpunkte, die mir in Zukunft den Weg weisen werden, und funkelnde Diamanten, an denen ich mich ein Leben lang erfreuen werde. Ich war frei, ich alleine bestimmte über mein Tun und wandelte voller Zuversicht meinem Traum entgegen.
Am 18. Tag meiner Reise erreichte ich St. Nazaire, ich schritt über die riesige Hafenbrücke, setzte mich einfach nur auf eine kleine Holzbank und betrachtete die vorbeieilenden Menschen. Diese simple Holzbank und der wohltuende Genuss sich auf ihr zu entspannen mag für Millionen von Menschen eine alltägliche Normalität sein, für mich war sie damals etwas ganz Besonderes. Wohl kaum vorstellbar, wenn man zuvor nicht Tage und Wochen damit beschäftigt war, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Ich weiss, kein spektakuläres Finale, kein Feuerwerk keine Freudenschreie. Doch ich denke, wenn ich mich auf solche Abenteuer begehe, gibt es so etwas nicht. Das Ende ist jeweils nur die Bedingung, dass ich immer wieder aufbreche.
Aufbruch – Erfüllung – Heimkehr. Der Lauf der Dinge, das Streben nach meinen Träume und das Wissen, dass ich noch zu viel grösseren Abenteuern fähig bin.